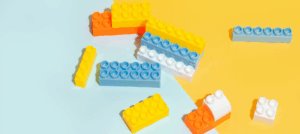Web 2.0 und Social Media sind aus dem Alltag eines stetig wachsenden Anteils der Deutschen nicht mehr wegzudenken. So zogen 2011 beispielsweise (zumindest gelegentlich) 70 % der deutschsprachigen Internetnutzerinnen und -nutzer Online-Enzyklopädien zurate, 58 % besuchten Videoportale wie YouTube und 42 % hatten ein Profil in einem privaten sozialen (Online-)
Netzwerk (vgl. Busemann & Gscheidle, 2011, S. 369).
Gleichzeitig erkennen immer mehr Unternehmen die Bedeutung von Social Media als Kommunikations- und Marketing-Instrument (vgl. Fink & Zerfass, 2010). Und auch in der universitären Lehre werden Social-Media-Anwendungen wie Microblogging-Systeme (vgl. Ebner, Lienhardt, Rohs & Meyer, 2010), Blogs (vgl. Brahm, 2007) oder Podcasts (vgl. Zorn, Auwärter, Krüger & Seehagen-Marx,
2011) immer häufiger eingesetzt.
Tenhaven, Ehlers, Tipold und Fischer (2010) führten bereits eine quantitative Untersuchung zur Medienkompetenz und zum Nutzungsverhalten u. a. von Web-2.0-Angeboten durch die Tierärzteschaft und Tiermedizinstudierende durch. Dabei stellten die Autoren fest, dass Web-2.0-Anwendungen von den meisten Tierärztinnen und Tierärzten bzw. Tiermedizinstudierenden vorwiegend passiv genutzt werden und der Bedarf z. B. an Podcasts vorhanden ist. Perspektiven für die Tiermedizin wurden in der Untersuchung allerdings nicht aufgezeigt.
Ziel der Arbeit
Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher, das Thema „Social Media in der Tiermedizin“ qualitativ zu untersuchen, um möglichst viele, ggf. auch bisher unbekannte Aspekte zu erarbeiten. Dabei sollen vor allem Perspektiven für die Tiermedizin formuliert werden.
Forschungsfragen
Der Arbeit liegen folgende Forschungsfragen zugrunde:
- Welche Rolle spielen Social Media für Tierärztinnen und Tierärzte bzw. Tiermedizinstudierende?
- Welche Nutzungsperspektiven ergeben sich für die Zukunft?
Dabei werden Hemmnisse aufgedeckt und motivationale Komponenten erschlossen.
Dazu werden zwei Unterfragen formuliert:
-
- Welche Rolle spielen Early Adopters (im Sinne des Diffusion-of-Innovation-Konzepts [vgl. Rogers, 2003]) im Hinblick auf die zukünftige universitäre und berufliche Anwendung von Social Media durch Tiermedizinstudierende bzw. Tierärztinnen und Tierärzte?
Die Hypothese zu dieser Unterfrage lautet:
Early Adopters spielen eine bedeutende Rolle im Hinblick auf die zukünftige universitäre und berufliche Anwendung von Social Media durch Tierärztinnen und Tierärzte bzw. Tiermedizinstudierende.
- Welche Rolle spielen Early Adopters (im Sinne des Diffusion-of-Innovation-Konzepts [vgl. Rogers, 2003]) im Hinblick auf die zukünftige universitäre und berufliche Anwendung von Social Media durch Tiermedizinstudierende bzw. Tierärztinnen und Tierärzte?
-
- Wie wird sich der Eintritt der Net Generation (vgl. Tapscott, 1997) in die Universitäten und tierärztlichen Praxen auf den universitären und beruflichen Gebrauch von Social Media durch Tierärztinnen und Tierärzte bzw. Tiermedizinstudierende auswirken?
Die Hypothese zu dieser Unterfrage lautet:
Zwar wird die Net Generation firm im privaten Umgang mit Social Media sein, eine Medienkompetenz im Hinblick auf die universitäre bzw. berufliche Nutzung von Social Media muss jedoch auch diese Generation zunächst erwerben.
- Wie wird sich der Eintritt der Net Generation (vgl. Tapscott, 1997) in die Universitäten und tierärztlichen Praxen auf den universitären und beruflichen Gebrauch von Social Media durch Tierärztinnen und Tierärzte bzw. Tiermedizinstudierende auswirken?
Methoden
Methodisch wurden insgesamt 5 leitfadengestützte Experteninterviews mit Tierärztinnen bzw. Tierärzten geführt, die aufgrund ihres beruflichen Umfeldes mit Social Media in Verbindung gebracht werden konnten. Die Interviews wurden transkribiert und einer qualitativen Inhaltsanalyse mit Kategorisierung unterzogen.
Inhalt
In Kap. 2 wird zunächst der theoretische Hintergrund zum Thema Social Media, zur Tierärzteschaft und zum Konzept der Diffusion of Innovation bzw. der Net Generation vorgestellt.
Nach einer Beschreibung der anwendeten Methoden (Kap. 3), werden die Ergebnisse der qualitativen Analyse präsentiert (Kap. 4) und diese anschließend in einen Gesamtkontext mit dem Stand der Forschung gebracht und diskutiert (Kap. 5).
Im Schlussteil (Kap. 6) werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick für weitere Untersuchungen formuliert.