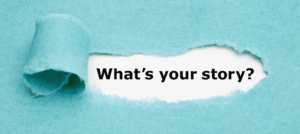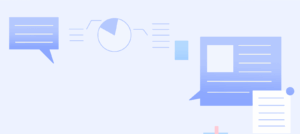Ich bin der festen Überzeugung: Wir alle tappen regelmäßig in die Falle des False-Consensus-Effekts. Denn schließlich bringen wir viel Erfahrung und Wissen in unsere Projekte ein. Doch genau hier liegt die Krux: Nur weil wir diese Erfahrungen gemacht haben, heißt das nicht, dass es den Userinnen und Usern genauso geht.
Aber eines nach dem Anderen: Schauen wir erstmal, worum es beim False-Consensus-Effekt überhaupt geht.
Was ist der False-Consensus-Effekt?
Der False-Consensus-Effekt, manchmal auch als Consensus Bias bezeichnet, beschreibt die Tendenz von Menschen, zu glauben, dass ihre eigenen Meinungen, Überzeugungen und Eigenschaften bei anderen häufiger und normativer sind, als dies tatsächlich der Fall ist, und dass Meinungen, Überzeugungen und Eigenschaften, die andere haben, die sie aber nicht teilen, eher auf die Persönlichkeit einer Person im Allgemeinen hinweisen.
Den Begriff False-Consensus-Effekt prägten die Psychologen Lee Ross, David Greene und Pamela House. Im Jahr 1977 beschrieben sie damit die Tendenz, die eigenen Verhaltensentscheidungen und -beurteilungen als relativ üblich und den gegebenen Umständen angemessen anzusehen, während alternative Reaktionen als ungewöhnlich, abweichend oder unangemessen betrachtet werden.
Warum UX-Designer:innen oft in die False-Consensus-Falle tappen
Als UX-Designer:in steckst Du oft tief in deinem Projekt, kennst jede Anforderung deiner Stakeholder, hast die Konkurrenzprodukte analysiert und deine eigenen Schlüsse gezogen. Und genau das wird zur Herausforderung: Denn je mehr du dich mit dem Design vertraut machst, desto leichter übersiehst du, was für deine Nutzer:innen verwirrend oder unklar sein könnte.
Der False-Consensus-Effekt verstärkt dieses Problem, da Designer oft glauben, dass ihre Gedanken und Entscheidungen stellvertretend für eine breitere Nutzerbasis stehen. Klar, du denkst: „Das sieht doch super aus, logisch, dass das jeder versteht!“ Aber deine User könnten eher so reagieren: „Was zum … Ich finde hier überhaupt nichts.“ Nielsen hat es treffend formuliert: „You are not the user.“
Ein typisches Beispiel: Das Hamburger-Menü. Für jeden UX-Designer völlig klar und verständlich. Für viele Nutzer:innen (besonders ältere) aber ein Rätsel.
So beeinflusst der False-Consensus-Effekts dein UX-Design
Der False-Consensus-Effekt beeinflusst dein UX-Design auf viele Arten. Hier einige häufige Missverständnisse, die in der User Experience auftreten können.
Navigation zu komplex. Angenommen, du gestaltest die Navigation einer E-Learning-Plattform oder eines digitalen Produktes. Für dich als Designer:in ergibt die Struktur absolut Sinn – du kennst den Inhalt und hast alles im Blick. Aber für Nutzer:innen, die neu auf der Plattform sind, sieht das unter Umständen ganz anders: Sie könnten von der Menge der Informationen oder der Komplexität der Hierarchie, aber auch vom Wording der Navigationselemente überfordert sein.
Technikaffinität überschätzen. Eine weitere häufige Fehlannahme ist, dass alle User technikaffin sind. Vielleicht bist du technikversiert und erwartest, dass die meisten Nutzer schnell verstehen, wie man z. B. eine Datei hochlädt. In Wirklichkeit könnten viele Nutzer damit Schwierigkeiten haben, besonders wenn sie unerfahren oder älter sind.
Verliebt in eigene Features. Der False-Consensus-Effekt führt manchmal auch dazu, dass du dich von den echten Bedürfnissen deiner Nutzer:innen entfernst. Und so implementierst du Funktionen und Features, die du – oder vielleicht deine Stakeholder – als wertvoll erachtest. Die User hingegen brauchen oder verstehen die Funktion aber gar nicht. Das kann dazu führen, dass die Usability und letztlich die Akzeptanz des Produkts leiden. Ein Beispiel dafür sind komplizierte „Power-User“-Funktionen, die nur eine sehr kleine Zielgruppe tatsächlich benötigt, die aber den Großteil der Nutzer nur überfordern.
Doch glücklicherweise gibt es ein paar Strategien, die dir helfen, den False-Consensus-Effekt zu minimieren.
7 Tipps gegen den False-Consensus-Effekt im UX-Design
Der False-Consensus-Effekt ist eine kognitive Verzerrung, die wir nie ganz abstellen können. Aber es gibt effektive Strategien, um seine Auswirkungen zu minimieren.
1. User Research und User Tests als Gegenmittel. User Research ist dein stärkstes Mittel gegen den False-Consensus-Effekt. Sprich mit deinen Nutzer:innen, führe Tests durch und hol dir echtes Feedback. Wahrscheinlich wirst du dich wundern, wie sehr ihre Bedürfnisse von deinen Annahmen abweichen. Methoden wie Usability-Tests oder A/B-Tests helfen dir, deine Annahmen zu überprüfen. Und wenn du dich auf echte Daten stützt und nicht nur auf deine Intuition, wird dein Design gezielter auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sein.
2. Zusammenarbeit im Team und die Rolle von Feedback. Neben der Arbeit mit den Nutzerinnen und Nutzern hilft es auch, regelmäßig Feedback von Teammitgliedern einzuholen. Unterschiedliche Perspektiven – bestenfalls in einem crossfunktionalen Team – können dabei helfen, eigene Annahmen zu hinterfragen. Agile Arbeitsweisen, bei denen früh und oft Prototypen getestet werden, fördern diese Feedback-Schleifen.
3. Personas erstellen und nutzen. Personas sind fiktive, aber auf realen Daten basierende Nutzermodelle, die typische Nutzergruppen repräsentieren. Wenn du dich bei Designentscheidungen auf diese Personas fokussierst, fällt es dir leichter, den Unterschied zwischen deinen eigenen Vorlieben und den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer zu erkennen. Wichtig ist, die Personas regelmäßig zu aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie die aktuelle Nutzerbasis widerspiegeln.
4. Kontextualisierte Nutzerbefragungen. Neben generellen Usability-Tests können kontextualisierte Befragungen, bei denen Nutzer in ihrem tatsächlichen Nutzungsumfeld beobachtet oder befragt werden, dabei helfen, den Unterschied zwischen deiner Annahme und dem Verhalten der Endnutzer zu verdeutlichen. So erfährst du, wie die Nutzer das Produkt in der Realität verwenden, und erkennst Missverständnisse oder Fehlannahmen.
5. Empathy Mapping. Eine Empathy Map ist ein einfaches, aber effektives Tool, um besser zu verstehen, was Nutzer denken, fühlen, sehen und tun. Dabei geht es darum, dich bewusst in die Lage des Nutzers zu versetzen und durch gezielte Fragen, den Designprozess mit einem tieferen Verständnis anzugehen. So kannst du eigene Biases herausfiltern.
Was denkt der User? Welche Sorgen hat er?
6. Datengetriebenes Design. Setze auf Datenanalysen und Nutzungsstatistiken etwa aus Google Analytics oder Matomo, um den Erfolg und die Akzeptanz deiner Designentscheidungen zu messen. Heatmaps, Click-Tracking oder Funnels können dir zeigen, wie Nutzerinnen tatsächlich interagieren und ob deine Annahmen über ihr Verhalten korrekt sind. Durch regelmäßige Datenüberprüfung minimierst du den Einfluss des False-Consensus-Effekts.
7. „Beginner’s Mindset“ einnehmen. Versuche, den Blickwinkel eines Anfängers einzunehmen, wenn du an einem Design arbeitest. Selbst wenn du ein Experte für das Thema bist, kann es helfen, sich vorzustellen, dass du das Produkt zum ersten Mal nutzt. Was würde dich verwirren? Welche Informationen bräuchtest du? Ein „Beginner’s Mindset“ kann dir helfen, die eigenen Annahmen zu hinterfragen und nutzerfreundlichere Designs zu designen.
Fazit
Bleib offen für Feedback und hinterfrage deine Designentscheidungen regelmäßig. Der False-Consensus-Effekt lässt sich nicht komplett vermeiden, aber mit jedem User-Test kommst du der idealen User Experience ein Stück näher.